
Erlebnispark Weltkrieg.
Originaltitel: Dunkirk
Produktionsland: Großbritannien, USA, Frankreich, Niederlande
Veröffentlichungsjahr: 2017
Regie: Christopher Nolan
Drehbuch: Christopher Nolan
Produktion: Emma Thomas, Christopher Nolan
Kamera: Hoyte van Hoytema
Montage: Lee Smith
Musik: Hans Zimmer
Darsteller: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy, Michael Caine
Laufzeit: 107 Minuten
Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen: Als Hitlers Streitmacht im Mai 1940 seinen Feldzug nach Westen antritt und in die Benelux-Staaten einfällt, müssen die überraschten Soldaten Frankreichs und Großbritanniens den Rückzug antreten. Doch tausende alliierte Kämpfer – Briten, Franzosen, Belgier und Niederländer – werden nahe der nordfranzösischen Küsten-Ortschaft Dünkirchen (im Englischen: Dunkirk) eingeschlossen. Die Chancen, diese Soldaten noch zu retten, stufen die Befehlshaber als äußerst gering ein.
Quelle: moviepilot.de
Replik:
Christopher Nolan, ein Auteur des Unterhaltungskino, ein Vorantreiber des amerikanischen Bombastkinos, immer auf der Suche nach einer neuen filmischen Herausforderung, die sich in diskutierbarer Unschärfe zwischen kommerzieller Aufmerksamkeitshascherei und künstlerischer Legitimität gigantomanischer, filmischer Großbauten befindet, macht mit Dunkirk“ nun einen Film, der sich einer hierfür ungewöhnlichen Episode des Zweiten Weltkriegs annimmt. Die Niederlage und Evakuierung der britischen Armee in der französischen Küstenstadt Dünkirchen nämlich, die von militärischer Passivität, geschichtlicher Mysteriosität und einem resignativen Defätismus geprägt ist. Also gerade nicht der klassisch-heroische anglosächsische Kriegsfilmtopos, dem man einem Christopher Nolan mit seinen Zugeständnissen an die Erzählkonventionen des Hollywoodkinos zutrauen würde. Kann das gut gehen? Nicht wirklich. Auch wenn Kritiker aus ganz unterschiedlichen Ecken in „Dunkirk“ Nolans vielleicht besten Film sahen, ist die gewählte Form gerade das große Problem der unfraglich spannenden Prämisse.

Hypokritische Trinität
Nolan selbst proklamierte „Dunkirk“ als Geschichte über das Überleben anstatt eines Kriegsfilmes. Und die Motivation, seinem Film eine eigenem, kriegsfilmabweichende Form zu geben, merkt man ihm an. Tatsächlich gibt es keine klassischen Gefechtsszenen, es wird viel davongelaufen, gestorben und kollektiv von einem unsichtbaren und nie wirklich namentlich gemachten Feind in Angst und Schrecken gesetzt. Gerade weil das Überlebenwollen gegen einen übermächtigen, diffus-gesichtslosen Feind hier entschieden im Fokus steht, ist die hier angewandte filmische Strategie des Nicht-Wissens und der relativen Willkür zunächst einmal sinnig. Warum „Dunkirk“ aber schlussendlich gerade nicht die gedichthafte Meditation über die Fragilität menschlichen Lebens geworden ist, hängt damit zusammen, dass Nolan seine Form nicht zu Ende gedacht hat und sich mal mehr mal und mal weniger kläglich in Zugeständnisse an konventionelles Erzählkino verliert.
Und es ist bemerkenswert, wie vielfältig Nolan seine eigene Prämisse zu verwässern weiß. Das fängt bei der Teilung der Geschichte in drei Erzählsegmente an, die in Erde, Wasser und Luft spielen und sogar drei verschiedene Zeitebenen (eine Woche, ein Tag, eine Stunde) mit sich bringen. Nolans makrodramatische Architektonik, wie er die Handlungsstränge in einander verwebt, funktioniert im Großen und Ganzen schon. Sie ist nur völlig kontraproduktiv für das Gefühl, das der Film erzeugen möchte und leidet auch unter der variierenden Qualität der drei Stränge. Wieder einmal erweist sich die Makrostruktur von Nolan als selbstgenügsames Gadget, anstatt ein dienendes Gerüst der Prämisse zu sein.
1. Zu Boden: Im Erlebnispark
Der erste Strang erzählt von einem Infanteristen (Cillian Murphy), der versucht auf ein Marineschiff zu gelangen, um nach England abtransportiert zu werden. Aber auch auf dem Schiff ist er nicht in Sicherheit vor den immer währenden deutschen Flieger-Angriffen. Es ist sehr viel Krach-Bum in diesem Strang, aber es ist die wesentlichste. Die einzige, in der es wirklich um das Überleben gibt. Das Problem nur: Es ist nicht spürbar. Nolan macht aus dem Überlebenskampf an den Dünkirchener Landungsbrücken ein tosendes, aber immerzu durchschaubares Spektakel. Die Bilder sind flüchtig, Sklaven des gnadenlos vorgegebenen Erzähl- und Schnitttempos. Sie haben keine Kraft, weil sie sich nicht trauen, stehen zu bleiben und innezuhalten. Die Szenen selbst, ob nun gerade ertrunken, zerfetzt oder anderweitig gestorben wird, folgen einer immer wiederkehrenden Logik, der nach der Protagonist nicht sterben darf. Durch ihren Schemencharakter und ihr akkumulatives Auftreten — auch gekoppelt mit einer auffällig jugendfreundlichen Darstellung von Kriegsbrutalität — haben die ach-so-intensiven Überlebenskampf-Situationen auch rein dramatisch keine Kraft. Sie degradieren sich selbst zur Erlebnisparkcharakteristik. Und nein, so war Krieg sicherlich nie.

2. Zu Luft: Ein wohltuender Realismus
Die Luft-Episode, in der ein von Tom Hardy verkörperter Supersoldat in einer Spitfire haufenweise deutsche Flieger vom Himmel holt, ist sicherlich die für sich stehend beste. Obwohl die Zeitstruktur der Stunde gegenüber des Tages und der Woche eigentlich eine besonders schweißtreibende Dramaturgie prädestinieren würde, erlaubt sich Nolan hier geradezu Momente der Ruhe und Verschnaufspause. Dieses Auskosten von Zeitlichkeit erzeugt hier eine realistische Haptik, weswegen sich ironischerweise die CGI-affinsten Episode der drei noch am ehesten authentisch anfühlt. Weil sie sich weniger in vorhersehbare Herzschlag-Rhythmik auflöst und weniger an den ganz großen Bildern interessiert ist. Trotzdem fragt man sich am Ende des Films aber, was Tom Hardys Höhenflug zur Gesamtkomposition großartig beiträgt, außer dass er als Ort- und Zeitelement die künstliche Dreiteilungsspielerei aufrechterhält, die Nolan für sein Kino der Großspurigkeit braucht wie die Luft zum Atmen.
3. Zu Wasser: Der ewigwährende kleine Held
Und dann ist da noch die dritte Episode, in der ein alter britischer Seemann, der vor kurzem seinen ältesten Sohn im Krieg verloren hat, begleitet vom jüngsten Sohn und seinem Freund, sich aufmacht, den Ärmelkanal zu durchqueren und britische Soldaten von der Küste privat zu evakuieren. Tatsächlich hat sich das alles so im Jahre 1940 ereignet; knapp 400.000 britische Soldaten wurden tatsächlich durch das (natürlich staatlich motivierte, aber letztlich) private Engagement der britischen Küstenstädter zurück in die Heimat gebracht, wo die Army sich regenerieren, neu staffeln und schließlich ihren Teil zum Sieg der Alliierten beitragen konnte. Die filmische Darstellung hier ist allerdings in gleich zweierlei Hinsicht problematisch:
3.1. Tausende Papkameraden
Der erste Grund ist ein sehr pragmatischer. Aus einer Eitelkeit heraus hat Christopher Nolan auf den Einsatz von CGI verzichtet, wo es nur ging, um den großen Echtheitsgrad des Films betonen zu können. Das Problem ist, dass es lächerlich ist, eine Evakuierung von knapp 400.000 Soldaten zu behaupten, wenn im Bild gut sichtbar, eine Menge von maximal einigen paar tausend zu sehen sind. Genauso unglaubwürdig verkommt die finale Rettungsaktion privater Seeleute, wenn gerade mal zwei Handvoll Schiffe ins Bild geschwommen kommen. Das mag zwar kleinliche Technikkritik sein, aber einem Film, der sich selbst so sehr dem hochtechnischen Bombastkino, samt satter Totalen vom statistenbefüllten Strand verpflichtet fühlt, sei diese Schwäche nichtdestotrotz erwähnt, zumal sie wirklich effektiv einer atmosphärischen Entwicklung und historischen Glaubwürdigkeit entgegenwirkt.

3.2. Saving Privately
Der zweite Punkt betrifft den innersten Kern von Nolans Film. Es ist eigentlich absurd, wie Nolan hier eine Geschichte einer Niederlage und eines Rückzugs noch zu einer pathetischen Heldengeschichte aufbläst. Nicht falsch verstehen: Der Patriotismus eines rationalen Rückzugmanövers, wie ihn Nolan hier huldigt, ist im Grunde, unter all den Massen an siegestrunkenen Welterrettungsfantasien alliierter Kriegsaufarbeitungen, eine gar erfrischende und legitime Spielweise. Aber der Hans-Zimmer-durchtränkte Heldenpathos, der sich vor allem in der furchtbar geschriebenen See-Episode exemplarisch gibt und zum Ende exponentiell ansteigt, wirkt nicht nur wie unnötig und unpassend im Nachhinein auf den dreiteiligen Dramaturgiekomplex draufgeklebt, er macht den Film schlussendlich doch noch zu einer ganz und gar austauschbaren Heldenreise Spielbergscher Manier. Gerade da, wo man Hoffnungen haben durfte, dass Nolan sich von dem Kitsch seines letzten Films „Interstellar“ verabschiedet hatte und über das (Über)leben wirklich tief sinniert und poetisiert, kommt die dramatische Zuspitzung in ernüchternd schmierigen Konventionszugeständnissen daher.
Selektives Erzählen oder schon Geschichtsklitterung?
Und überhaupt: War das Spannende an der Schlacht von Dünkirchen nicht die bis heute ungeklärte Ursache, warum Hitler der Wehrmacht einen Halte- und Sammelbefehl gab, der den Einsatz von Panzern aufsparte? Durch diesen strategischen Fehler, der nach neuestem Stand der historischen Interpretation von Hitler selbst gegen den Willen seiner Generäle durchsetzte, konnte Dünkirchen erst evakuiert werden und Großbritannien weiterhin im Zweiten Weltkrieg teilnehmen. Ist das Spannende an dieser im Film kaum beleuchteten Mysteriösität nicht, dass das Überleben tatsächlich einem umgeklärten Wunder gleichte? „Dunkirk“ hätte ein Film über das ambige kollektive Memento Mori der letzten bzw. als letzte geglaubte Lebensminuten werden können. Das Hoffen, Beten, Warten, Sich-Abfinden, Genießen letzter Lebensfunken, Zweifeln, Freuen über kleine Dinge, Staunen vor dem Schauspiel des Krieges, in dem neben all dem Schrecken auch eine unfragliche phänomenologische Schönheit liegt. Ein Terrence-Malick-Film ohne schnöden Off-Kommentar vielleicht, die Bilder dazu hat „Dunkirk“. Sich mit dieser geradezu transzendentalen Frage nach der Dankbarkeit für das eigene Weiterleben wäre ein viel tieferer, reicherer und größerer Film gewesen, als ein solcher, der die Errettung der Menschen auf die Union-Jack-Flagge einiger weniger Fischerboote schreibt.
56%
Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Syncopy / Warner Bros. Home Entertainment
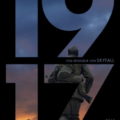
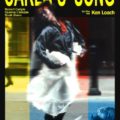

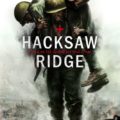
3 thoughts on “Dunkirk (mediumshot)”